Ich bin einem kleinen Dorf in den Niederlanden, in Zeeland, und sehe mir eine Gedenktafel für den 1. Februar 1953 an. Dort steht die Geschichte der großen Sturmflut.
Damals änderte sich die Welt für immer. Die Deiche rissen ein, das Wasser nahm alles mit sich, auf das es ein Recht hatte. Es wollte das Gebiet wieder zurückerobern, das ihm abgenommen wurde. Von Naturgewalt braucht man keine Rücksicht zu erwarten. Das Wasser riss das Land an sich, es riss Häuser und Menschen an sich, Wiesen und Vieh, Autos und Kirchen.
Ich sehe um mich. Die Landschaft sieht friedlich aus.
An diesem heißen Sommertag kann ich mir die Katastrophe von damals kaum vorstellen. Ich steige wieder aufs Fahrrad und fahre nachdenklich weiter, halte bei einem Café an. Es schmiegt sich an eine Düne, am Ende der Straße.
Auf der Terrasse sitzt eine Gruppe Rentner unter einem dunkelgrünen Sonnenschirm. Eine der Frauen hat ein kleines Gesicht mit Doppelkinn. Dieses Gesicht sieht man heutzutage nur noch selten, man erkennt es höchstens noch auf einem Gemälde aus einem vergangenen Jahrhundert. Still sieht sie vor sich hin, auf die Dünen, die hier anfangen. Es ist gerade 12 Uhr mittags, ein sanfter Wind bewegt die Gräser. Sie riecht das Meer nicht, so behauptet sie. Sie riecht fast nichts, aber sie hört den Wind in den Bäumen, dort, wo der Dünenweg ist. Und sie sieht noch gut, wenn sie die richtige Brille auf hat. Ein Mann sitzt ihr gegenüber, er nickt abwesend, trinkt ein Trappistenbier, eine Frau mit weißen Haaren und einem gestreiften T-Shirt sitzt neben ihr. Es ist still am Tisch, keiner hat es eilig, bis plötzlich ein halblauter Gedanken aufkommt.
– Kann ich schon essen? fragt die Frau aus dem vergangenen Jahrhundert.
Ihre Begleitung mit Streifenshirt antwortet ihr.
– Ja! Du kannst jetzt essen. Du hast deine Tabletten vor zwei Stunden genommen. Also kannst du jetzt essen, was du willst. Hast du denn Hunger?
Sie überlegt kurz.
– Nein, überhaupt nicht.
– Dann solltest du etwas Leichtes essen, etwas Normales. Vielleicht etwas Banales.
Eine Möwe segelt lautlos über die Tische hinweg.
– Was nennst du banal?
– Einen Toasti vielleicht. Magst du das? Es gibt hier gute Toastis.
– Ja, gut. Dann bestell ich mir das, oder? Zum Wein.
Der Mann am Tisch hält sein Glas, trinkt langsam, zittert nur leicht. Er sieht in die Ferne und sagt nichts.
Auf dem Muschelsandweg hält eine Frau mit dem Fahrrad, sie hat einen Hund im Fahrradanhänger dabei. Sie steigt ab, lehnt das Rad gegen den Holzständer. Dann lädt sie ihr süßes Teil ab. Es hat große Augen und weiches Fell mit Schleife. Es ist ihr elegantestes Teil, das sich fast geräuschlos und mit leichten Hüpfern über den Sand bewegt, Nase in der Luft. Sie nennt es Schatz. Sie behauptet –Jetzt sind wir da, sie redet nickend andere Menschen an, meint –Sie ist immer ganz entspannt.
Behutsam nimmt sie die entspannte Hündin auf den Arm und geht die Treppe über die Düne hoch, zum Aussichtspunkt. Ich sehe ihnen nach.
Eine Frau im Sommerkleid kommt auf die Terrasse. Auch sie hat einen Hund dabei, sie hält ein Ende der Leine in der Hand. Am anderen Ende befindet sich ihr tierisches Teil. Das hat sie schon vor langer Zeit ausgelagert. Sie nennt es wilde Maus. Es ist struppig, durchgedreht, tollpatschig. Es schnüffelt hektisch zwischen den Tischen herum, zieht Richtung Bank, unter der sich ein weiterer Hund aufhält, der beschnuppert werden muss, aber die Leine lässt das nicht zu. Maus, sage ich leise. Es interessiert ihn nicht. Maus zieht hechelnd die Frau im Sommerkleid weiter, zickzack über die Terrasse.
Der Hund unter der Bank sieht sein eigenes Herrchen an. Er will alles richtig machen, vielleicht gibt es dann etwas zu fressen. Er hört komm und sitz und platz und bleib, und gehorcht. Herrchen sieht den Hund zufrieden an und nickt. Seine Begleitung flirtet mit dem Kellner, der aber zu jung ist, um es zu verstehen. Sie sieht den platten Hund auf dem Boden an und isst langsam ihre Bouletten, ohne etwas davon abzugeben. Der Hund weiß natürlich nicht, dass es zu seinem Schutz ist, er hat keine Ahnung davon, wie sich holländische Bouletten im Magen verhalten, er weiß nur, da ist etwas, was lecker riecht und er will es haben.
Aber wie jeder Hund stellt auch dieser kaum Bedingungen. Unermüdlich spielt er die Rolle, die ihm zugedacht wurde. Er seufzt, liegt neben dem Tisch, sieht seine Begleiter mit treuen Augen an und wartet einfach. Zwischendurch verzieht er immer mal wieder die Schnauze, um so präzise wie möglich seine Besitzer zu spiegeln. Er will das tun, wofür man ihn ausgewählt hat. Er ist zeitlos.
Die Rentner unterm Schirm sitzen still am Tisch, halten ihre Gläser, trinken langsam, sehen in die Ferne. Ich stehe auf, grüße kurz, steige auf mein Fahrrad und fahre in den Dünenweg hinein.
Nachmittags am Strand ist das Wasser sehr weit weg, spiegelglatt liegt es unter der heißen Augustsonne. Es scheint endlos zu sein, der Übergang von Wasser in Luft ist wegradiert. Als wäre es eine Filmkulisse.
Ich sehe die Streifen im Sand, wo die Ebbe sich zurückgezogen hat.
Erst gegen Abend zeichnet sich der Horizont wieder scharf ab. Je tiefer die Sonne sinkt, um so klarer und satter werden die Farben, das Meer sieht wie gegossenes Blei aus. Es ist windstill.
Gegenüber von der untergehenden Sonne wird gleich der Vollmond aufgehen. Springflut. Ich denke wieder an die Dörfer, die geflutet wurden, an die Menschen, denen alles genommen wurde. Viele sind geflüchtet, einige sind geblieben, ohne Besitz, ohne greifbare Erinnerungen. Sie konnten ihr Leben erzählen, aber beweisen konnten sie es nicht. Haben sie überhaupt vorher gelebt? Hatten sie wirklich ein Haus und eine Arbeit? Eine Familie? Beziehungen? Sie mussten alles neu erfinden. Wie Flüchtlinge aus Kriegsgebieten haben sie ihre Nachbarn verloren, ihre Familien, ihre Eltern und Kinder.
Sie mussten sich ein neues Leben aufbauen, aus Erinnerungen und aus Sachen, die sie irgendwann gelernt haben, die irgendwo im Erbgut gespeichert sind. Sie haben neue Verbindungen geknüpft, malten sich eine Zukunft aus. Aber wo kommen sie her? Was geben sie von Generation zu Generation weiter? Das werden sie nie greifen können. In einer fernen Geschichte oder im Traum einer stürmischen Winternacht werden sie vielleicht etwas erkennen. Aber sie werden ein Leben lang auf der Flucht sein, auch wenn sie ein neues Zuhause gefunden haben.
Nachdenklich gehe ich über den Strand. Am Horizont sehe ich den Umriss der Schiffe, die aus dem Hafen von Rotterdam losgefahren sind. Gleich geht der Mond auf. Ich habe es nicht eilig.
Ich sehe eine Gruppe Jugendlicher, ihre Stimmen sind weit zu hören, sie lachen, rufen und rennen hinter einem roten Ball her. Sie haben Musik dabei, der Rucksack mit Getränken liegt im Sand.
Eine Möwe segelt lautlos über den Dünen.
Auf dem glatten Meer liegen gelbe Bojen. In der Ferne steht der Leuchtturm. Er sendet seine Signale. Die Sonne geht unter. Die Flut kommt.


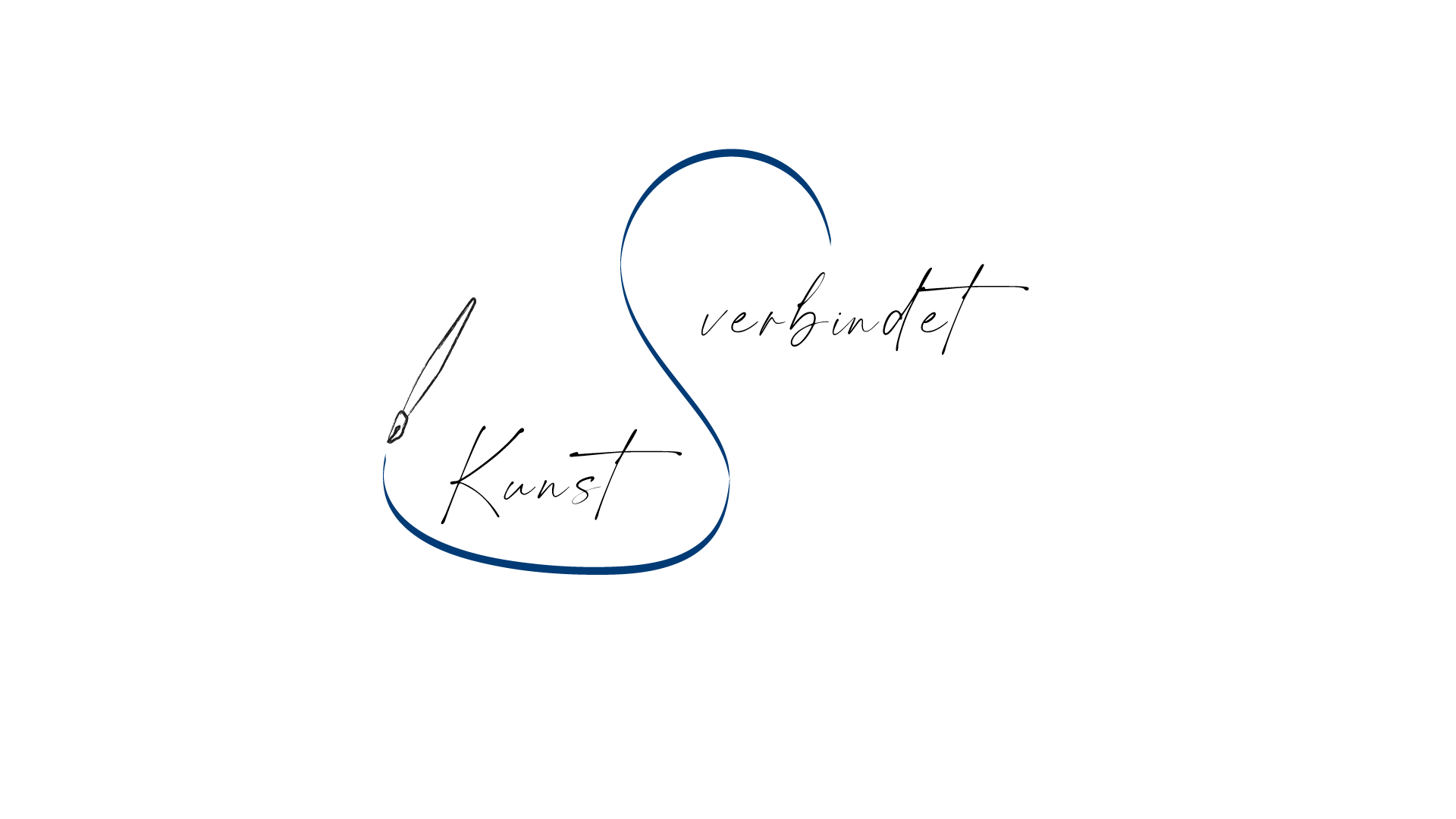
Comments